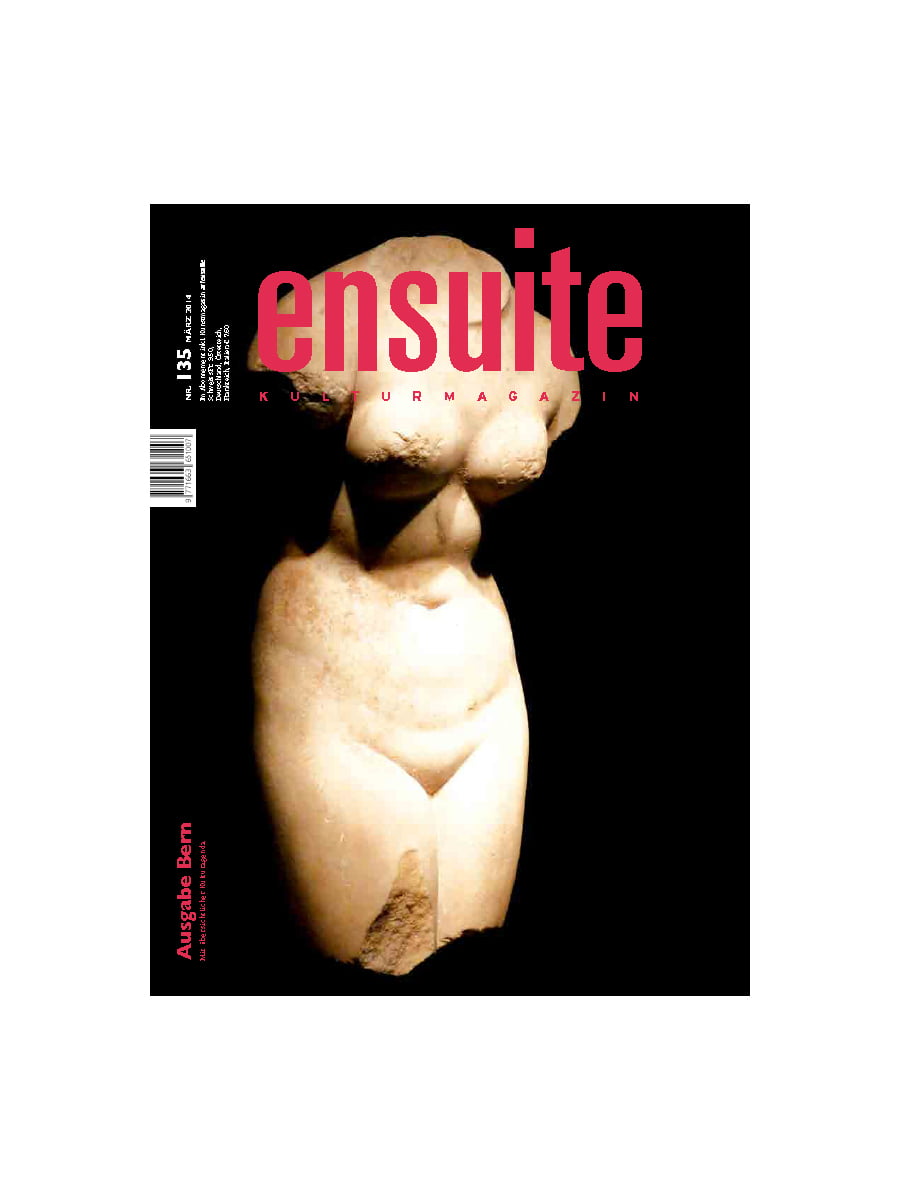Von François Lilienfeld – Es gab eine Zeit, da war Lortzings Oper «Zar und Zimmermann» streckenweise die meistgespielte Oper auf deutschsprachigen Bühnen. In der Liste der meistaufgeführten Opernkomponisten in Deutschland rangierte Lortzing auf dem dritten Platz – nach Mozart und Verdi!
Seine Spielopern – neben «Zar und Zimmermann» vor allem «Wildschütz» und «Waffenschmied» – waren Allgemeingut, ja, man kann fast sagen: Volksgut. Die Lieder, welche bei ihm oft die Opernhandlung unterbrechen und meistens meditativen Inhalt haben, konnte jeder Opernfreund trällern. Viele seiner Verse – Lortzing schrieb seine Texte zum großen Teil selbst – wurden zu geflügelten Worten («Das war eine köstliche Zeit»; «O selig, o selig, ein Kind noch zu sein»; «Oh, ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht»…).
Die Werke sind fast vollständig an deutschsprachige Aufführungsorte gebunden. Sie sind unübersetzbar, und von den Interpreten wird nicht nur eine gute deutsche Aussprache, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis des Deutschen verlangt. So schön seine Musik ist: Der dramaturgische Gesamteindruck, das Zusammengehen von Text und Musik, nicht zuletzt in den mit fast Mozartscher Meisterschaft aufgebauten Ensembleszenen, ist Voraus
setzung für eine gelungene Aufführung.
Mozart war Lortzings großes Vorbild, und er selbst spielte besonders gerne Mozartsche Rollen. Eines seiner frühen «Liederspiele» heißt «Szenen aus Mozarts Leben» (1833). Das knapp eine Stunde dauernde Stück nimmt es zwar mit den historischen Tatsachen nicht so genau, ist aber musikalisch faszinierend: Lortzing benutzt Werke von Mozart, vor allem kammermusikalische Stücke, und bearbeitet sie auf verblüffende Art, mit Überraschungen, jedoch ohne den Geist Mozarts zu verraten.
Lortzing war in erster Linie Sänger und Schauspieler, «Gaukler» wie er sich mal stolz, mal mit Bitternis nannte, dann nämlich, wenn man ihn nicht ernst nahm. Seine Stimme soll sehr zart gewesen sein, sein Tonumfang jedoch war verblüffend, trat er doch sowohl als Pedrillo wie als Don Giovanni auf. Auch im Sprechtheater war er zuhause, tragische Rollen spielte er allerdings ungerne.
Das Theaterblut hatte er von beiden Eltern. Sein Vater war Lederhändler und, wie auch seine Mutter, begeisterter Amateurkomödiant in Berlin, im Verein Urania. Die Theaterbegabung war wohl größer als der Geschäftssinn: Der Laden ging Pleite, und die Lortzings wurden professionelle Theaterleute. Der kleine Albert stand schon früh in Kinderrollen auf der Bühne.
Er hatte es nicht leicht. Trotz mehreren großen Erfolgen war oft Schmalhans Küchenmeister. Er musste dafür kämpfen, dass seine Werke aufgeführt wurden: Die Konkurrenz, vor allem aus Italien und Frankreich, war groß, Intrigen an der Tagesordnung, und Tantiemen wurden im Prinzip keine bezahlt. Die Theaterdirektoren, die freiwillig Aufführungsrechte ausrichteten, waren seltene Ausnahmen. Mit dem Verkauf einer Partitur für eine einmalige Abgeltung verlor der Komponist alle Rechte – die Urheberrechtsschutz-Institutionen (GEMA, SUISA & Co.) kamen erst sehr viel später…
Um zu überleben war Lortzing, vor allem in seinen letzten Lebensjahren, gezwungen, ständig in billigen Schwänken aufzutreten. Nur selten war es ihm vergönnt, als Dirigent aktiv zu sein, eine Tätigkeit, die ihn weit mehr interessierte als die «Gaukelei». Aber Frau und Kinder mussten ernährt werden. Seine Ehe mit Rosine Regina Ahles, die er im Theatermilieu kennenlernt hatte, war sehr harmonisch. Elf Kinder wurden geboren; fünf davon starben im zartesten Alter.
Neben Liederspielen und Spielopern finden wir in Lortzings 1994 von Irmlind Capelle herausgegebenem Werkverzeichnis auch das Oratorium «Die Himmelfahrt Jesu» und die berückend schöne romantische Märchenoper «Undine». Und, nicht zu vergessen, seine 1848 komponierte, drittletzte Oper: «Regina».
1848 – ein Jahr, das in Europa große Hoffnungen und ebensogroße Enttäuschungen hervorrief. Lortzings Durst nach Freiheit war stark; oft genug musste er sich mit der Zensur herumplagen, litt unter sozialer Ungerechtigkeit, empörte sich gegen Fürstenwillkür. Allerdings war ihm auch gewaltsamer Umsturz und Blutvergießen ein Greuel. Die Prinzipien der französischen Revolution lagen ihm nahe, das Terrorregime verabscheute er. Sein Ideal war der «gute Herrscher»: Peter der Große in «Zar und Zimmermann», Meister Stadinger im «Waffenschmied», Fabrikbesitzer Simon in «Regina». 1848 war er von den Auswüchsen der revolutionären Freischärler ebenso schockiert wie von der Repression durch das Regime.
«Regina» ist keine Revolutionsoper – sie wurde aber von den Ereignissen des Jahres angeregt und ist ein Ausdruck von Lortzings Credo: Freiheit, soziale Gerechtigkeit, aber Gewalt nur unter direkter Bedrohung.
Revolutionär – im dramaturgischen Sinne –ist aber die Introduktion zum ersten Akt: Noch nie hatte sich in einer Oper der Vorhang über einem Fabrikgelände mit Hochkaminen und streikenden Arbeitern gehoben. Geschäftsführer Richard erklärt letzteren, dass Verhandlungen, die er mit dem Fabrikbesitzer Simon führen wird, den besseren Weg darstellen («Recht soll euch werden»).
Richard ist mit Simons Tochter Regina verlobt. Doch Werkmeister Stephan, der sich einer Gruppe Freischärler anschließt, begehrt sie auch. Er überfällt mit seinen Kumpanen die Fabrik, legt Feuer und entführt Regina. Nach einer Reihe dramatischer Ereignisse erschießt Regina ihren Entführer, Sekunden bevor dieser eine Fackel in einen Pulverturm werfen kann. Die große Explosion ist verhindert, und alle stimmen in einen patriotischen Chor ein. Denn hier geht es um Freiheit, aber auch um ein «einiges Vaterland». Es soll das Mosaik der Vielstaaterei in «Deutschland» ersetzen.
Als Lortzing im Oktober 1848 das Werk vollendet hatte, war die Zensur mit neuer Schärfe zurückgekehrt. Somit war an eine Aufführung des Stückes nicht zu denken. 1899, 48 Jahre nach des Komponisten Tod, kam sie auf die Bühne der Hofoper in Berlin, total verfälscht, mit dem Kampf gegen die Franzosen als Thema. 1953 kam eine kommunistisch verbrämte Fassung in Rostock zur Aufführung. Eine «echtere» Version konnte man 1981 in Oberhausen erleben. Eine authentische, kritisch edierte Aufführung erlebte die Oper erstmals 1998 in Gelsenkirchen.
Die CD-Firma cpo hat zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk im Januar 2011 zwei Aufführungen im Münchner Prinzregententheater mitgeschnitten. Aus dieser Aufzeichnung entstand die erste vollständige «Regina»-Aufnahme. Sie hat nicht nur Repertoire-Wert, sondern ist auch von der Qualität her erfreulich. Johanna Stojkovic (Sopran) und Daniel Kirch (Tenor) stellen das Liebespaar Regina/Richard sowohl stimmlich wie dramatisch überzeugend dar. Der Bariton Detlef Roth meistert die schwierige Partie des sich gegen das Schicksal auflehnenden Bösewichtes Stephan gekonnt, und der Bass Albert Pesendorfer gibt einen würdigen Vater und Fabrikbesitzer, wobei man sich von ihm etwas mehr Legatogesang gewünscht hätte.
Großen Anteil an der schönen Aufführung haben der Prager Philharmonische Chor, das Münchner Rundfunkorchester und der überlegen dirigierende Ulf Schirmer.
Wer mustergültige Aufnahmen von Lortzings Spiel- und Märchenopern sucht, wird im Katalog der Firma Sonimex fündig. Sie macht Radio-Aufnahmen aus den 50er-Jahren zugänglich. Diese lange Zeit unveröffentlichten Dokumente sind Zeugnisse einer goldenen Zeit der Lortzing-Interpretation. Hohes Niveau in Gesang und Diktion, Beherrschung des unverkennbaren Spielopern-Stils, Dirigenten, die mit leichter Hand die orchestralen Finessen und die Dramaturgie der Ensembleszenen herausarbeiten: All diese Eigenschaften finden sich auf diesen auch klanglich durchaus befriedigenden Kostbarkeiten. Große Sängerpersönlichkeiten lassen die Einspielungen zu vokalen Leckerbissen werden. Um nur einige Beispiele zu nennen:
«Undine» (1951): Trude Eipperle (Titelrolle), Christa Ludwig (Bertalda), und – besonders bewundernswert – Ferdinand Frantz, sonst vor allem als Wotan und Hans Sachs bekannt, der seine mächtige Stimme mühelos an den lyrischen Stil des Wassergeistes Kühleborn anpasst.
«Zar und Zimmermann» (1956): Hermann Prey (Zar); Kurt Böhme als van Bett, der damals noch im Vollbesitz seiner prachtvollen Baßstimme war, und zwar sehr komödiantisch auftritt aber noch ohne das bei ihm später so störend auftretende Chargieren.
«Waffenschmied» (1958): Hanna Scholl (Marie), Gottlob Frick (Stadinger), Hermann Prey (Graf von Liebenau).… und viele Andere!
Foto: zVg.
ensuite, März 2014