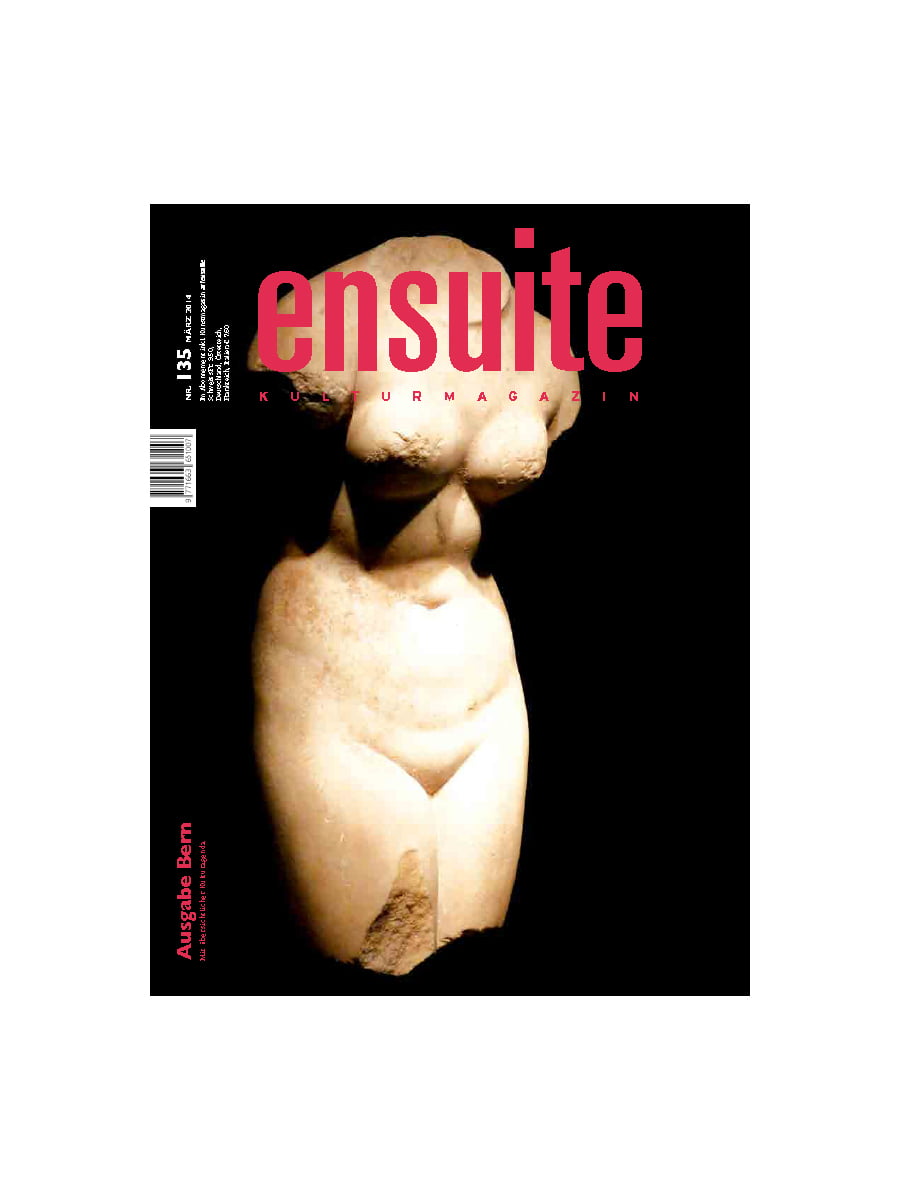Von François Lilienfeld – Die Karriere des berühmten rumänischen Dirigenten ging ungewohnte Wege. 1945, nach der deutschen Kapitulation, suchten die Berliner Philharmoniker einen neuen Chefdirigenten. Wilhelm Furtwängler war mit zeitweiligem Dirigierverbot belegt, da er «entnazifiziert» werden musste. Ihm, als dem Berühmtesten, war eine Sündenbockposition quasi vorgezeichnet. Er hatte deutschnational empfunden und war politisch von sehr großer Naivität; aber ein Nazi war er nie, und kurz vor Kriegsende flüchtete er, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, in die Schweiz. Zahlreichen Verfolgten hatte er außerdem tatkräftig beigestanden.
Die Philharmoniker wählten Leo Borchard. Doch der hatte kaum seine Position eingenommen, als er irrtümlicherweise von einem amerikanischen Wachsoldaten erschossen wurde.
Nun erhielt ein junger rumänischer Student mit ein bisschen Dirigiererfahrung seine Chance: Sergiu Celibidache konnte das Orchester interimistisch, d.h. bis zu Furtwänglers Rückkehr, übernehmen. Eine riskierte Sache; doch seine Musikalität, sein feuriges Temperament und sein weitläufiges Repertoire verschafften ihm sofort große Erfolge. Als Furtwängler wieder am Pult der Berliner stehen durfte, teilte er sich mit ihm in die Leitung der Konzerte. Furtwängler starb 1954, und Celibidache wäre der logische und ideale Nachfolger gewesen. Doch es kam anders: Ein gewisser Herbert von Karajan wurde gewählt, ein überzeugter Nazi, der auch das Dirigentenpult durch seine Führermentalität prägen sollte und der einen überwiegenden Anteil an der zunehmenden Kommerzialisierung des klassischen Musikbetriebes haben würde. Diese Wahl war ein persönlicher Affront gegen den jungen Rumänen, außerdem ein politisch und künstlerisch skandalöses Ereignis.
Celibidache war zutiefst verletzt und kehrte den Berliner Philharmonikern definitiv den Rücken. Fortan reiste er viel und hatte feste Stellen in Stockholm, Stuttgart und zuletzt München inne.
Celibidache verweigerte sich dem Aufnahmestudio fast vollständig. Eine große Menge seiner Radio- und Fernsehhauftritte wurde jedoch mitgeschnitten und posthum von seinem Sohn veröffentlicht. Er wollte das Werk seines Vaters – auch in Dokumentarfilmen – weiterleben lassen, und fand offizielle, qualitativ hochstehende Veröffentlichungen besser als die schon früh zahlreich verbreiteten Piratkopien. Die Aufnahmen stammen aus Celibidaches Spätzeit, als seine Interpretationen, nicht zuletzt durch seine philosophischen Meditationen, immer langsamer wurden. Wie anders er in seiner Berliner Zeit musizierte, kann man, dank zwei CD-Sammlungen aus dem Hause audite, erleben.
Schon 2011 waren 3 CDs mit RIAS-Mitschnitten erschienen (audite 21.406). Sie enthielten hauptsächlich Werke des 20. Jahrhunderts, darunter viel Musik, die im 3. Reich verboten war. Besonders erstaunlich, wie Celibidache die Berliner in Musik einführte, die ihnen damals total fremd war: Ravels «Symphonie Espagnole» etwa, oder, noch verblüffender, Gershwins «Rhapsody in Blue». Ein von heiligem Feuer gepackter Dirigent führt großartige Musiker auf neue Pfade! Auch Werke von Heinz Tiessen (1887–1971), Celibidaches Dirigierlehrer, können wir hören, sowie das leider immer noch vernachlässigte, wunderbare Violinkonzert von Ferruccio Busoni (1866–1924), mit Siegfried Borries, dem Konzertmeister des Orchesters, als Solisten.
Neu sind nun 13 CDs auf den Markt gekommen, unter dem Titel «The Berlin Recordings – 1945–1957» (audite 21.423). Sie bieten ein sehr breitgefächertes Repertoire, eingespielt mit den Philharmonikern und dem Rundfunk-Symphonie-Orchester Berlin.
Schon eines der ältesten Dokumente – die Vierte Symphonie von Brahms (21. Nov. 1945) – ist eine absolute Sternstunde. Leidenschaft und Lyrik, große Bögen und Detailtreue geben sich die Hand; die Philharmoniker klingen besser und vor allem interessanter als ein Jahrzehnt später unter H.v.K., und dies obschon das Haus des Rundfunks in diesem kalten ersten Nachkriegswinter wohl kaum geheizt war!
Drei Tage vor der Brahms-Symphonie dirigierte Celibidache das Dvorák-Cellokonzert mit Tibor de Machula als Solisten. Hier kommen zwei temperamentvolle Persönlichkeiten zusammen, die sich, insbesondere im ersten Satz, gegenseitig aufzumuntern scheinen. Dies hindert sie nicht daran, auch dem lyrischen Teil gegen Schluß des Finales vollauf gerecht zu werden. Der Cellist beeindruckt durch seinen gekonnten Einsatz des Portamento; allerdings stört im zweiten Satz ein starkes, ständiges Vibrato.
Es würde den gegebenen Rahmen sprengen, alle Werke aufzuzählen und zu besprechen. Erwähnenswert ist jedoch die große Anzahl Raritäten, vor allem aus Russland und Frankreich, welche diese Sammlung enthält. Auch Werke, die wir später in Celibidaches Programmen seltener antreffen werden – Haydn, Vivaldi – ermöglichen lohnende Begegnungen. Überraschend ist das Fehlen zweier Komponisten, die später in den Mittelpunkt von Celibidaches Tätigkeit rücken werden: Schumann und Bruckner.
Eine Kuriosität stellt die Bonus-CD dar: eine unvollständige Version von Beethovens Siebenter Symphonie. Sie wurde am 7. Okt. 1957 vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin eingespielt. Das Original-RIAS-Band wurde gelöscht; denn der Dirigent stampft, schreit und singt fast ständig mit. Im Sender Freies Berlin fand sich jedoch eine Kopie, die die zwei ersten Sätze und einen Teil des Scherzos enthält. Eine rätselhafte Aufnahme: Kann es wirklich sein, dass Celibidache so selbstvergessen war? Hatte er extrem schlechte Laune? Er probte gerne sehr «lautstark»: handelt es sich etwa um eine – öffentliche – Probe? Wie dem auch sei, die Interpretation ist sehr fragwürdig: Das langsame Tempo im Hauptteil des ersten Satzes klingt wie eine Vorahnung auf Kommendes, wohingegen das rasende Scherzo fast unspielbar und gänzlich unüberzeugend ist. Ein faszinierendes Dokument … aber nicht unbedingt ein Hörgenuss.
Ganz anders Beethovens Dritte «Leonore»-Ouvertüre (10. Nov. 1946). Auch hier sind die Tempi extrem: Nach einer sehr langsamen Einleitung gleitet Celibidache mit einem Accelerando in einen sehr forsch musizierten Hauptteil – eine eigenwillige Auffassung, die hier jedoch dramaturgisch überzeugt. Die Wucht, mit welcher der Dirigent die Berliner Philharmoniker aufspielen lässt, ist höchst beeindruckend.
Die technische Qualität der Überspielungen ist ausgezeichnet, und das Beiheft enthält genaue Angaben und sehr aufschlussreiche Texte.
Foto: zVg.
ensuite, März 2014