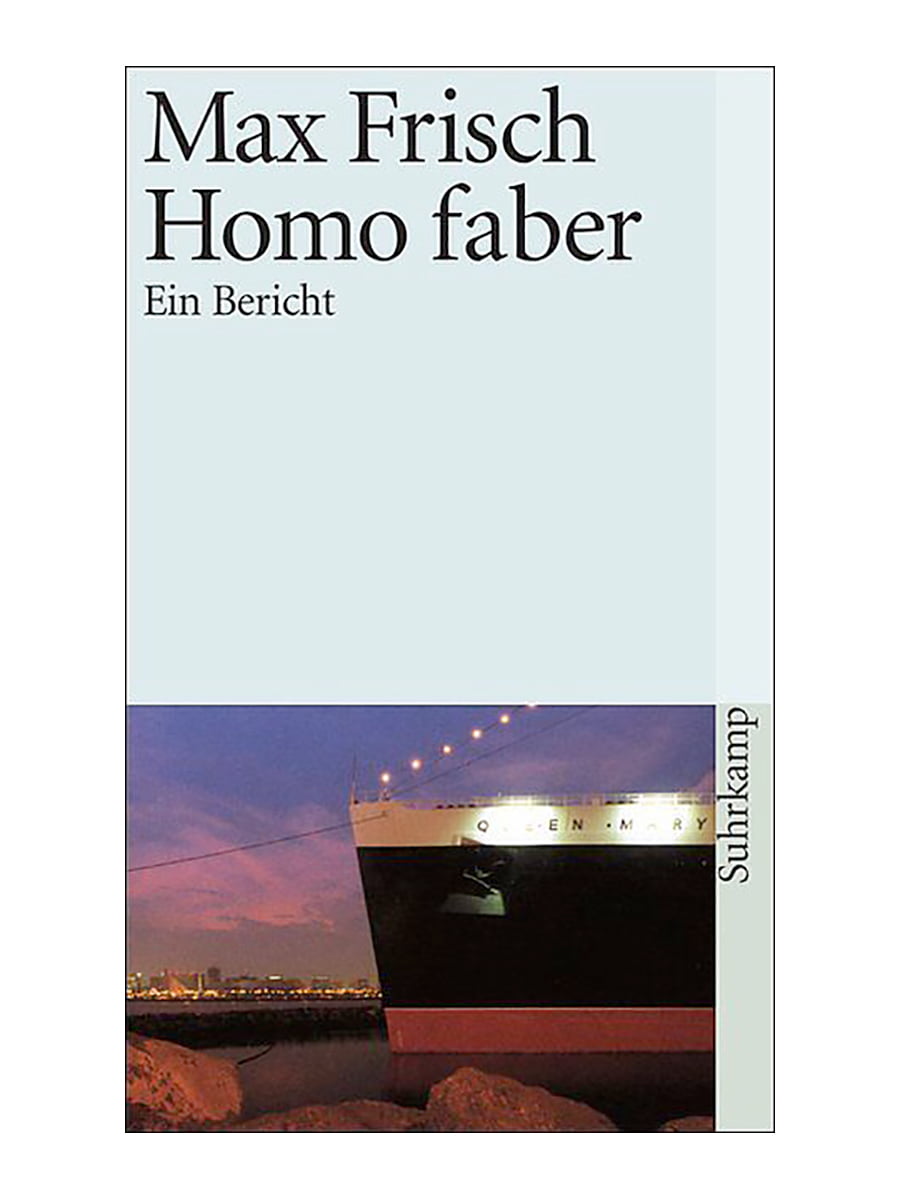Von GuerillaGirl laStaempfli – Vorbemerkung: Homo Faber von Max Frisch gilt als eines der bestuntersuchten Werke der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Frischs Roman ist seit Jahrzehnten Pflichtstoff an deutschsprachigen Schulen. Im Zentrum stehen die Kaltherzigkeit, die völlige Selbstüberhöhung sowie der Inzest des Protagonisten. Die Kritiker, damals wie heute, finden dies „urmenschlich“, archetypisch gar und enorm modern. Tatsächlich strotzt der Roman voller Phantasmen eines alternden Mannes mit riesigen Frauenproblemen. Homo Faber ist ein manieristisches, anbiederndes, erbauungsloses, gemütsloses, in Teilen auch höchst sexistisches und antisemitisches Werk. Es ist das sprechende Zeugnis der – selbst so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – weiter gepflegten Herrenmoral.
Dies erkennt, wer die Rollen tauscht. Darf ich vorstellen: Gynä Faber.
GYNÄ FABER. EIN KURZBERICHT.
Wir starteten in Paris, Flughafen Charles de Gaulle, mit dreistündiger Verspätung infolge einer Terrorwarnung. Der Flughafen war voller Frauen in Anzügen mit ihren teils verschleierten, teils modern gekleideten Ehemännern. Unter diese Paare mischten sich viele hübsche junge Studenten, die ich allein bei ihrem Anblick gerne in weiblich-charmanter Art hätte besteigen mögen. Diese offensichtliche Gier auf männliches Jungfleisch teilte ich mit der Frau, die neben mir sass. Normalerweise gucke ich nicht auf Frauen, doch diese hatte was: Die Art und Weise wie sie ihren Mantel auszog, wie sie sich setzte, wie sie sich ihre Hose zurecht rückte. Die selbstsichere Art einer Frau, die Geschäfte macht, diese aber nicht zum Überleben braucht. Wir warteten und nickten einander kumpelinnenhaft zu – so wie dies zwei Businessfrauen angesichts süsser Männer halt so tun.
Ich war todmüde.
Igor hatte drei Stunden lang, während wir den Berichten der neusten Terrorattacke lauschten, auf mich eingeredet. Er wolle angesichts der Bedrohungslage unsere Beziehung fixieren, er liebe mich so sehr wie noch nie eine Frau zuvor. Mich ärgerte sein Geschwätz. Als Technikerin glaube ich nicht an Liebe oder Schicksal, sondern ich bin gewohnt, mit Formeln, Codes und algorithmischen Herausforderungen zu arbeiten. Schicksal? Ein lächerliches Rückblickverfahren, das nichts mit der Realität zu tun hat. Das Unwahrscheinliche ist eine Erfahrungstatsache, hat nichts mit Mystik, sondern lediglich mit Beobachtung und Daten zu tun. Nur einmal im Leben habe ich mich einem Schwärmer und musisch verwirrten Künstler hingegeben, darüber hinaus ein Halbjude. Das reicht für mehrere Generationen, um zu wissen: Männer wollen, egal wie attraktiv, intelligent, himmlisch verführerisch sie sind, nur das eine. Igors Anfall, dass ich ihn doch endlich heiraten solle, lag in seinem Wunsch nach einem Kind von mir.
Die Terrorwarnung am Flughafen entpuppte sich schliesslich als Farce und wir konnten endlich ins Flugzeug einsteigen und den normalen Lauf einer ganz normalen Reise auf uns nehmen. Mein Auge für Ästhetik registrierte die vielen sehr jungen und attraktiven Männer, ebenfalls in Hosenanzügen. Sie waren sicherlich die Assistenten all der Expertinnen, Juristinnen, Medizinerinnen, Informatikerinnen, Politikerinnen, die sich im Flugzeug auf den Weg an die Weltgesundheitskonferenz begaben. WGK ist eines dieser Gremien, die Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatten mit dem Ziel, die Frauengesundheit des Westens auch ärmeren Gegenden zugänglich zu machen und globale Pandemien zu verhindern.
Meine ältere Nachbarin folgte meinem etwas lüsternen Blick zu den jungen Männern, nicht bös gemeint, sondern einfach nur normal, sie lächelte und meinte: „Die gab es zu unserer Zeit noch nicht, nicht wahr?“ Ich nehme an, sie meinte die vielen Hosenanzüge an Männern, die daran erinnerten, dass Männer nur dann eine Chance haben aufzusteigen, wenn sie mit Benehmen, Habitus und Bekleidung Frauen imitieren.
Ich nickte, behielt jeoch Distanz selbst als die Businessfrau erzählte, dass sie als Managerin für Seltene Erden im Rahmen einer volkschinesischen Firma unterwegs sei.
Ich weiss nicht, warum sie mir letztlich auf die Nerven ging. Vielleicht lag es an ihrem sehr deutschen Gesicht. Ihre Art, alles und jeden zu beurteilen, zurechtzurücken, zu bemessen und in grösster Selbstsicherheit völlig unvermittelt über das Judentum sprechen zu kommen, vor allem natürlich über die Lage im Nahen Osten, ach, es sei ja so furchtbar, wie sich Israels Politik zum Apartheidsstaat entwickle und was ich denn von Frau Netanjahu halte, deren Ehemann sich so unglaubliche Luxuseskapaden leisten würde. Oder die Mauer in Israel, diese furchtbare Mauer, die die armen Palästinenser, die schon seit Generationen endlich auf Frieden und Demokratie hofften, einsperrte. Kurz, sie redete ununterbrochen. Ihre Welt war sehr deutsch; sie wurde in gut und böse geteilt, die Amerikaner, seit Donna Trump unbelehrbar dumpf und blöde, die Russen seit jeher verschlagen, aber immerhin sorge Alexandra Putin für Ruhe, kurz, als ich einwarf, naja, die USA hätten immer noch die besten Denkerinnen aller Zeiten und Alexandra Putin sorge nicht nur für Ruhe, sondern auch für Krieg, unterbrach mich die Deutsche und meinte, ich könne dies nun wirklich nicht verstehen, da ich doch Schweizerin sei, und wann hätten die Männer eigentlich das Männerwahlrecht gekriegt? Sie lachte laut. Als ob die Geschichte ihres Landes punkto Männerrechte nur Ruhmesblätter verteilen könnte.
Ich seufzte. Ich war mir derartige Herablassungen, Jahrzehnte nach dem Krieg, durchaus gewohnt und ich erinnerte daran, dass die Mehrheit der Deutschen, wäre es nach Morgenthau gegangen, heute noch in irgendeinem Saustall Nürnberger Würste produzieren würden. „Ach, lassen wir doch diese ollen Kammellen“, meinte sie. Ich musste Waser lassen. Auf der Toilette überlegte ich mir kurz, ob es sich denn lohnen würde, der Kollegin noch weitere Lektionen in Geschichte und Finanzen zu erteilen. Ich entschied mich dagegen.
Ob ich für die Europäische Union arbeite?
Ich spürte meine Wechseljahre. Eierstöcke, die sich zurückzogen, ein blödes Gefühl. Nicht schmerzhaft, einfach da. Diese Eierstöcke. Die Potenz meiner Weiblichkeit. Des überlegenen Geschlechts. Ich lächelte. Ja, ich sei international tätig sei, seit zwanzig Jahre schon in der EU und das als Schwyzzerin, haha, lustig, nicht? I mean, eine hohe Tätigkeit innehaben für die EU und dies aus einem Land stammend das gar nicht Mitgliedstaat war. Die Deutsche gab sich amüsiert, aber doch beeindruckt. Ich strahlte wieder die mir eigene unschlagbare Intelligenz aus – Frauen können das. Trotzdem war ich froh, die Maschine zu verlassen, der teutonischen Blondine ein gepflegtes Businesslächeln rüberzubeamen, so von Frau zu Frau.
***
Am Flughafen nahm ich mir ein Londoner Taxi, erfreute mich an dem kehligen Westend-Dialekt der Fahrerin, die schon die halbe Welt bereist, doch nirgends soviel Aufregendes wie in der britischen Metropole erlebt hatte. Ich stieg in der Nähe von Hamstead Heath ab, in meiner Vergangenheit eines völlig anderen Lebens. Der Geruch jahrhundertealter Kolonialherrschaft umarmte mich: Leder, Zigarren, überall Frauen in Schale, Krawatten, eine Fliegenträgerin sass da, Mittelalter, gesetzt, erfolgreich, vermögend, sei es von zuhause aus oder selbstgemacht. Die Bedienung: Ein junger wohlgebauter junger Mann, die Locken züchtig zum Pferdeschwanz gereiht, die Shorts den Blick freigebend auf seine umwerfenden nie enden wollenden Beine. Er war kein Londoner von Geburt an. Das sah frau sofort. Nein. Er war eine dieser unglaublichen Mischungen, irgendwo zwischen Afrika und Asien, umwerfend. Ich bestellte bei ihm einen Monkey 47, Gin Tonic, über den eine coole Reporterinnen des Gonzo-Journalismus radikal subjektiv, polemisch, humorvoll mal schrieb: „Was fehlt? Nichts. Es ist schliesslich Monkey 47.“ Ich schaue dem Kellner tief in seine dunklen Augen, schmiege meinen Blick um sein Organ, das sich kräftig zwischen den Schenkeln abzeichnet. Er weiss, ich werde grosszügig sein.
Zum Zeitvertreib nahm ich die Neue Zürcherin zur Hand, die liegt überall rum, seit sie sich mit den global Mächtigen rund um Davos verbündet hat, und siehe da: Martine Frisch, die alte, die Literatin, die mit Igor Bachmann eine Affäre hatte, die ihn letztlich in den Selbstmord trieb, starrte mir entgegen mit einem Absatz aus ihrer Gynä Faber: „(…) der Neger plötzlich lachte – es schüttelte seinen Penis wie einen Pudding, so musste er lachen, sein Riesenmaul, sein Kruselhaar, seine weissen und schwarzen Augen, Grossaufnahme aus Afrika“. Der Text stand da, weil Mannisten und Antikolonialisten, die sogenannten Penisgeschlechter sich gegen die Schullektüre der Alten wehrten. Die Neue Zürcherin liess dies natürlich nicht auf sich sitzen. Grosse Expertinnen kamen in der Zeitung zu Wort. Die Philosophin Karola Paulina Liessfrau, die sich über die Empörung der alten Martine Frisch lustig machte, in brillianter Analyse, Georgina Orwell und Eugènie Ionesco zitierend, fantastisch. Ich hätte mich gerne auch zu Wort gemeldet. Einfach mit dem Hinweis, dass Martine Frisch eh in den Keller und Frederike Dürrenmatt in den literarischen Olymp gehöre. Frisch hatte nämlich keine Ahnung. Der Neger übrigens, der Martine Frisch so nannte und der in den Schulen immer noch so gelesen wird, was ich gemeinsam mit den Mannisten auch übel finde, also der Neger nahm in Frischs Erzählung das ihm angebotene Geld nicht an. Welch ein Faux-Pas! Kein Putzmann dieser Welt schlägt eine unverhofft in den Kittel gesteckte Note aus. Nie und nimmer. Die Lehre der Unterschicht ist: „Take the money and run.“ Doch Martine Frisch machte ihre Karriere ohne Recherche und Mitgefühl. Die war ja damals, so kurz nach dem Krieg, eh gefragt. Endlich kam mein zweiter Monkey 47. Die Gurke war förmlich zu spüren, wie sie zwischen meinen Schenkel, abgeleckt vom schnuggeligen Kellner geil hin- und herglitt. Ich sank in den Sessel und war zuhause.
***
Postskriptum: Homo Faber gehört aus dem Schulkanon gestrichen. Wenn schon Klassiker, dann nur „Die Wand“ von Marlene Haushofer. Passt eh besser zu Coronazeiten.